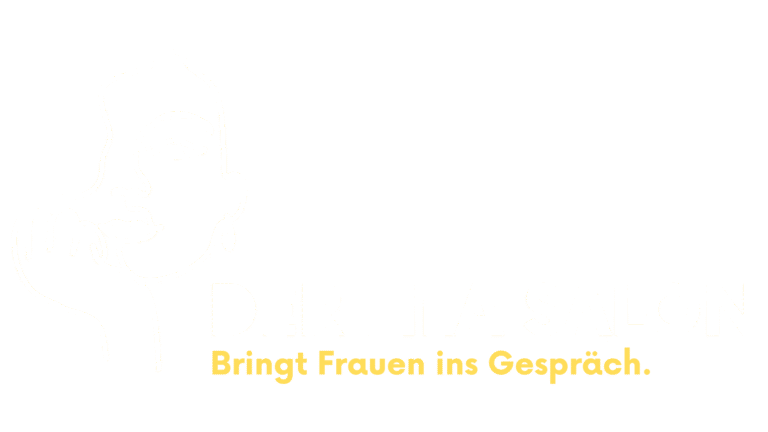Warum Lila? Und was ist ein Salon?
Was ist das für ein Name?
Die Farbe Lila. Vielleicht kennst du den gleichnamigen Filmklassiker. Falls nicht, schau ihn dir mal an, sehr lohnenswert. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman der US-amerikanischen Autorin Alice Walker, der 1982 erschien und mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. Whoopi Goldberg spielt die Afroamerikanerin Celie, die von ihrem Stiefvater missbraucht und dann als Ehefrau an einen Farmer verkauft wird, wo sie weitere Unterdrückung und Demütigung erfährt. Es vergehen viele Jahre, bevor Celie es schafft, ihrem Leben eine ganz neue Richtung zu geben. Aber das nur am Rande, als Tipp, für einen Tag, an dem du starke Nerven hast.
Lila ist als Farbe für unseren Salon leicht erklärt, ist es doch die Farbe der Frauenbewegung. Schon in der ersten Frauenbewegung ab ca. 1850 in Deutschland und England war Lila zusammen mit Weiß und Grün die bestimmende Farbe. Dabei symbolisiert, so heißt es, Lila bzw. Violett den Anspruch auf das Stimmrecht, Weiß die Ehre und Grün die Hoffnung auf den Neubeginn. Lila wird heute außerdem oft von Menschen verwendet, die sich für die gleichen Rechte für alle einsetzen – nicht nur für Frauen sondern für LGBTQ+
Und: Lila ist aktuell wie eh und je, derzeit vor allem in der Mode und im Design. Laut der Experten vom Farbinstitut Pantone ist lila die neue Trendfarbe des Jahres 2022 für Mode, Design und viele andere Produkte. Der Pantone Lila-Farbton trägt den Namen Very Peri. Er ist ein, so wird er beschrieben, warmer und fröhlicher Lila-Ton, der ein Gefühl von Zuversicht und Unbeschwertheit auslösen soll. Neben der politisch aufgeladenen Bedeutung der Farbe Lila fand ich es gut und auch passend, noch einen weiteren, fröhlichen Aspekt darin zu finden.
So hatte ich also die passende Farbe für unseren Salon ist.
Und dann kam ich auf den Salon. Ich wusste grob, dass der Salon etwas mit Frauenrechten und Emanzipation zu tun hatte. Beim Googeln erfuhr ich Erstaunliches und Bemerkenswertes, das ich mit Euch teilen möchte: Eine kurze Geschichte des Salons.
Die Salonkultur war über 200 Jahre hinweg die gesellschaftliche Form menschlicher Kommunikation. Führend dabei die französische Salonkultur des 17./18. Jahrhunderts. In den Salons trafen sich im privaten Umfeld, also innerhalb des häuslichen Herrschaftsbereich der Frauen, Menschen zu Gesprächen und Diskussionen. Der Salon entstand als Gegenbewegung zum höfischen Leben und entwickelte sich nach der französischen Revolution zu ihrer Blüte.
Die erste moderne Kämpferin für das Frauenwahlrecht war Olympe de Gouges. Sie verfasste im Laufe der französischen Revolution zunächst 1791 die “Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin”, die als Protest gegen die Männer-Privilegien zu verstehen war. Diese feministisch-revolutionäre Erklärung war noch in Druck, als die männlich geprägte bürgerliche Verfassung bereits angenommen und Frankreich eine konstitutionelle Monarchie geworden waren. Olympe de Gouges wurde im Sommer 1793 verhaftet (zur Zeit der Terrorherrschaft Robespierres) und im November 1793 nach kurzem Schauprozess hingerichtet.
Währenddessen war der Salon als Domäne der Frau zu einem Instrument geworden, gegen die Entrechtung der Frau anzukämpfen.
Die private Sphäre war von jeher der Machtraum der Frau. Während Männer ihre Macht im öffentlichen Leben auslebten, taten Frauen dies zurückgezogen im Heim – in ihrem Salon, in die sie andere Frauen zum Austausch einlud. Wenn wir so wollen, begann die Emanzipation der Frau durch den Salon!
Der Salon gab den Frauen erstmals die Möglichkeit, ohne ihre Ehemänner am öffentlichen Leben zu partizipieren, ja es sogar wesentlich zu beeinflussen.
Der Salon als feministische aber auch femininer Ort war vor allem ein Ort, der politisch und gesellschaftlich neutral war. Er ermöglichte Menschen unterschiedlichen finanziellen Standes, unterschiedlicher religiöser Abstammung, gesellschaftlichen Ranges, politischer Zuordnung und nationaler Abstammung einen Ort des Austausches und der Kommunikation.
Eine weitere Intention des Salons war auch jene der Etablierung einer Universität für Frauen. Frauen gingen in ihrem Salon mit den Männern in geistigen Wettbewerb.
Der Salon gab Frauen einen Ort der Autonomie, einen Ort, an dem sie selbstbestimmt diskutieren, sich eine Meinung bilden und entscheiden konnten.
Dieser Aspekt kommt vor allem bei den Salonières gegen Ende des 18. Jahrhunderts zu tragen, deren Hauptakteurinnen jüdische Frauen waren, die nicht nur für ihre Rechte als Frauen eintraten, sondern auch für ihre Freiheit innerhalb der jüdischen religiösen Erziehung. Sie kämpften nicht nur für die Emanzipation als Frau sondern auch für Ihre Emanzipation als Jüdische Frau.